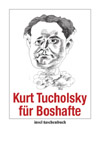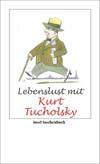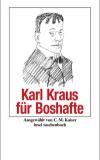Vermischtes
von Detlev von Liliencron (1844 – 1909)
Der Sturm preßt trotzig an die Fensterscheiben
Die rauhe Stirn; tiefschwarze Wolken treiben
Wie Fetzen einer Riesentrauerfahne,
Und schnell wie Bilder ziehn im Fieberwahne.
Wie Rettung suchend, zog, von Angst befangen,
In meine Arme dich ein heiß Verlangen.
Wie hold das war: Ein Blättchen, sturmgetrieben,
Flog mir ans Herz, dort ist es auch geblieben.
Clarisse1 - 1. Jun, 11:33
von Alfred Lichtenstein (1889 – 1915)
Erstarrter Mond steht wächsern,
Weißer Schatten,
Gestorbnes Gesicht,
Über mir und der matten
Erde.
Wirft grünes Licht
Wie ein Gewand,
Ein faltiges,
Auf bläuliches Land.
Aber vom Rand
Der Stadt steigt sanft
Wie fingerlose, weiche Hand
Und furchtbar drohend wie Tod
Dunkel, namenloses . . .
Wächst höher her
Ohne Ton,
Ein leeres, langsames Meer –
Erst war es nur wie eine müde
Motte, die auf letzten Häusern kroch.
Jetzt ist es schwarz blutendes Loch.
Hat schon
Die Stadt und den halben Himmel verschüttet.
Ach, wär ich geflohn! –
Nun ist es zu spät.
Mein Kopf fällt in die
Trostlosen Hände
Am Horizont ein Schein wie ein Schrei
Kündet
Entsetzen und nahes Ende.
Clarisse1 - 1. Jun, 11:30
Mittwoch, 28. Mai 2008
von Peter Panter [i. e. Kurt Tucholsky (1890 – 1935)]
Beim ersten Herannahen der Grippe, erkennbar an leichtem Kribbeln in der Nase, Ziehen in den Füßen, Hüsteln, Geldmangel und der Abneigung, morgens ins Geschäft zu gehen, gurgele man mit etwas gestoßenem Koks sowie einem halben Tropfen Jod. Darauf pflegt dann die Grippe einzusetzen.
Die Grippe – auch ‚spanische Grippe’, Influenza, Erkältung (lateinisch: Schnuppen) genannt – wird durch nervöse Bakterien verbreitet, die ihrerseits erkältet sind: die sogenannten Infusionstierchen. Die Grippe ist manchmal von Fieber begleitet, das mit 128° Fahrenheit einsetzt; an festen Börsentagen ist es etwas schwächer, an schwachen fester – also meist fester. Man steckt sich am vorteilhaftesten an, indem man als männlicher Grippekranker eine Frau, als weibliche Grippekranke einen Mann küßt – über das Geschlecht befrage man seinen Hausarzt. Die Ansteckung kann auch erfolgen, indem man sich in ein Hustenhaus (sog. ‚Theater’) begibt; man vermeide es aber, sich beim Husten die Hand vor den Mund zu halten, weil dies nicht gesund für die Bazillen ist. Die Grippe steckt nicht an, sondern ist eine Infektionskrankheit.
Sehr gut haben meinem Mann ja immer die kalten Packungen getan; wir machen das so, daß wir einen heißen Grießbrei kochen, diesen in ein Leinentuch packen, ihn aufessen und dem Kranken dann etwas Kognak geben – innerhalb zwei Stunden ist der Kranke hellblau, nach einer weiteren Stunde dunkelblau. Statt Kognak kann auch Möbelspiritus verabreicht werden.
Fleisch, Gemüse, Suppe, Butter, Brot, Obst, Kompott und Nachspeise sind während der Grippe tunlichst zu vermeiden – Homöopathen lecken am besten täglich je dreimal eine Fünf-Pfennig-Marke, bei hohem Fieber eine Zehn-Pfennig-Marke.
Bei Grippe muß unter allen Umständen das Bett gehütet werden – es braucht nicht das eigene zu sein. Während der Schüttelfröste trage man wollene Strümpfe, diese am besten um den Hals; damit die Beine unterdessen nicht unbedeckt bleiben, bekleide man sie mit je einem Stehumlegekragen. Die Hauptsache bei der Behandlung ist Wärme: also ein römisches Konkordats-Bad. Bei der Rückfahrt stelle man sich auf eine Omnibus-Plattform, schließe aber allen Mitfahrenden den Mund, damit es nicht zieht.
Die Schulmedizin versagt vor der Grippe gänzlich. Es ist also sehr gut, sich ein siderisches Pendel über den Bauch zu hängen: schwingt es von rechts nach links, handelt es sich um Influenza; schwingt es aber von links nach rechts, so ist eine Erkältung im Anzuge. Darauf ziehe man den Anzug aus und begebe sich in die Behandlung Weißenbergs. Der von ihm verordnete weiße Käse muß unmittelbar auf die Grippe geschmiert werden; ihn unter das Bett zu kleben, zeugt von medizinischer Unkenntnis sowie von Herzensroheit.
Keinesfalls vertraue man dieses geheimnisvolle Leiden einem sogenannten ‚Arzt’ an; man frage vielmehr im Grippefall Frau Meyer. Frau Meyer weiß immer etwas gegen diese Krankheit. Bricht in einem Bekanntenkreis die Grippe aus, so genügt es, wenn sich ein Mitglied des Kreises in Behandlung begibt – die andern machen dann alles mit, was der Arzt verordnet. An hauptsächlichen Mitteln kommen in Betracht:
Kamillentee. Fliedertee. Magnolientee. Gummibaumtee. Kakteentee.
Diese Mittel stammen noch aus Großmutters Tagen und helfen in keiner Weise glänzend. Unsere moderne Zeit hat andere Mittel, der chemischen Industrie aufzuhelfen. An Grippemitteln seien genannt:
Aspirol. Pyramidin. Bysopeptan. Ohrolax. Primadonna. Bellapholisiin. Aethyl-Phenil-Lekaryl-Parapherinan-Dynamit-Acethylen-Koollomban-Piporol. Bei letzterem Mittel genügt es schon, den Namen mehrere Male schnell hintereinander auszusprechen. Man nehme alle diese Mittel sofort, wenn sie aufkommen – solange sie noch helfen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge, ch ist ein Buchstabe. Doppelkohlensaures Natron ist auch gesund.
Besonders bewährt haben sich nach der Behandlung die sogenannten prophylaktischen Spritzen (lac, griechisch; so viel wie ‚Milch’ oder ‚See’). Diese Spritzen heilen am besten Grippen, die bereits vorbei sind – diese aber immer.
Amerikaner pflegen sich bei Grippe Umschläge mit heißem Schwedenpunsch zu machen; Italiener halten den rechten Arm längere Zeit in gestreckter Richtung in die Höhe; Franzosen ignorieren die Grippe so, wie sie den Winter ignorieren, und die Wiener machen ein Feuilleton aus dem jeweiligen Krankheitsfall. Wir Deutsche aber behandeln die Sache methodisch:
Wir legen uns erst ins Bett, bekommen dann die Grippe und stehen nur auf, wenn wir wirklich hohes Fieber haben: dann müssen wir dringend in die Stadt, um etwas zu erledigen. Ein Telefon am Bett von weiblichen Patienten zieht den Krankheitsverlauf in die Länge.
Die Grippe wurde im Jahre 1725 von dem englischen Pfarrer Jonathan Grips erfunden; wissenschaftlich heilbar ist sie seit dem Jahre 1724.
Die glücklich erfolgte Heilung erkennt man an Kreuzschmerzen, Husten, Ziehen in den Füßen und einem leichten Kribbeln in der Nase. Diese Anzeichen gehören aber nicht, wie der Laie meint, der alten Grippe an – sondern einer neuen. Die Dauer einer gewöhnlichen Hausgrippe ist bei ärztlicher Behandlung drei Wochen, ohne ärztliche Behandlung 21 Tage. Bei Männern tritt noch die sog. ‚Wehleidigkeit’ hinzu; mit diesem Aufwand an Getue kriegen Frauen Kinder.
Das Hausmittel Cäsars gegen die Grippe war Lorbeerkranz-Suppe; das Palastmittel Vanderbilts ist Platinbouillon mit weichgekochten Perlen.
Und so fasse ich denn meine Ausführungen in die Worte des bekannten Grippologen Professor Dr. Dr. Dr. Ovaritius zusammen:
Die Grippe ist keine Krankheit – sie ist ein Zustand –!
Clarisse1 - 28. Mai, 09:58
von Paul Scheerbart (1863 – 1915)
Die gebratene Flunder sitzt auf dem gelbseidenen Familiensopha und sinnt – lange.
Plötzlich springt sie auf und schaut den heiligen Nepomuk, der sich im Schaukelstuhl ein bißchen schaukelt, durchdringend an.
Dann ruft sie, während sie auf ihrem knusprigen Schwanze in der Stube herumhopst:
"Nepomuk, Du solltest Kaiser von Pangermanien werden – wahrhaftig! wirklich!"
"Du hast wohl", erwidert Nepomuk, "zuviel gebratne Butter im Kopp!"
Die gebratene Flunder springt auf den Tisch und singt die Marseillaise.
Da wird der heilige Nepomuk wütend und schlägt mit der Faust auf den Tisch.
Was geschieht?
Die Lampe fällt runter und explodiert.
Alles verbrennt und stirbt.
Die Asche gibt kein einziges Lebenszeichen von sich.
Hieraus erkennt man wieder, wieviel der Zorn zerstören kann.
Clarisse1 - 20. Mai, 10:21
Freitag, 28. März 2008
von Peter Panter / Theobald Tiger [i. e. Kurt Tucholsky (1890 – 1935)]
Der andere auch! Der andere auch!!
Der andere auch!!!
–
Eine kleine Sonntagspredigt
mit einem nachdenklichen Chanson
Auf der Erde leben einundeinedreiviertel Milliarde Menschen (die Anwesenden natürlich ausgenommen) – und im Grunde denkt jeder, er sei ganz allein, was die Qualität anbetrifft. "So wie ich . . ." denkt jeder, "so ist kein anderer – so kann kein anderer sein." Ob das wohl richtig ist?
Wir sehen den Verbrecher und den Jubilar als Einzelwesen und rechnen beiden das allgemeine Niveau mit an; es ist so, wie wenn sich ein Seehund rühmen wollte, daß er schwimmen kann. Alle Seehunde können es.
Da ist zum Beispiel der Beruf.
Sie kennen ja alle die Festreden, die bei der Jahresversammlung des Reichsverbandes wissenschaftlich geprüfter Traumbuch-Verfasser steigt: jeder Traumbuch-Verfasser ist mindestens ein Napoleon, ein Goethe, ein Rockefeller, ein . . . nach Belieben auszufüllen. Andere Berufe kommen da gar nicht mit. Vor wem erzählt der Mann das eigentlich? Damit kann er doch nur einem Eskimo imponieren, einem der nicht weiß, daß die in der Festrede gerühmten Eigenschaften heute so ziemlich alle zivilisierten Menschen besitzen: wir alle können telefonieren, ein Grammophon anstellen, das elektrische Licht anknipsen; viele von uns können chauffieren, viele haben Entschlußkraft, verstehen, sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden, können Reisedispositionen treffen – es ist die Zeit, die die Menschen so geformt hat; das Verdienst eines einzelnen ist es nicht. Aber das hören sie nicht gern – sie spielen vor sich selber und vor einem imaginären Publikum gern den Wundermann, "So schön wie ich das kann . . ." Verlaß dich drauf: der andere kann das alles auch.
Der Schriftsteller tut gern so, als sei er von einem Zauberwesen begnadet und als sei dies etwas ganz und gar Einzigartiges: schriftzustellern – und vergißt dabei, daß es Tausende und Tausende können, wie er. Der Arzt umgibt sich gern mit einer Atmosphäre des geheimnisvollen Medizinmannes (wobei nicht untersucht werden soll, inwieweit der Patient das braucht und wünscht). Der Industrielle tut gern so, als habe er allein – Herr Generaldirektor Bölk – Tatkraft, Klugheit und Umsicht der ganzen Welt gepachte . . . kurz: jeder will als Einzelwesen gewertet und möglichst verehrt werden und läßt unbewußt-bewußt außer acht, daß Millionen neben ihm und um ihn sind, die sich auf genau derselben Ebene bewegen wie er es tut.
Dagegen wehrt sich das Individuum – es ist sein letzter, sein verzweifelter Kampf gegen die unbarmherzige Uniformierung einer mechanistischen Zeit. Er will nicht. Er spielt: einmaliges Individuum.
Die Klugen (die Anwesenden natürlich eingeschlossen) geben das alles für den Beruf und für das Gemeinschaftsleben zu. "Aber", sagt jeder von ihnen, "aber . . . man hat doch da so seine kleinen Eigenheiten . . ." Und hier wird die Sache restlos komisch.
Denn grade bei den 'kleinen Eigenheiten' ist die Übereinstimmung so groß, daß man glauben sollte, die Menschen würden in Serien hergestellt.
Die Tage der Niedergeschlagenheit, wo alles aus ist: Beruf grau, Liebe danebengegangen, Geld flöten, Bücher langweilig, das ganze Leben verfehlt – der andere auch! Der merkwürdige Waldspaziergang damals, wo von den Fichten lauter Gestorbene heruntergrüßten und so schauerlich nickten, und wo du schneller gingst, weil du Furcht hattest, dich drüber ärgertest, Mut markiertest, und nun noch mehr Furcht hattest – der andere auch! Der wie ein Nieskitzel plötzlich auftretende Reiz, bei ganz ernsten Situationen lachen zu müssen, die Angst davor, das Bemühen, dieses blödsinnige Lachen grade noch herunterzuschlucken – der andere auch! Immer: der andere auch.
Du hast da morgens, wenn du dich anziehst, eine Reihe kleiner fast sakraler Handlungen . . . der andere auch. Du hast manchmal, bevor du in ein fremdes Haus gehst, die 'Portalangst' . . . der andere auch. Du bist mutig, sagen wir, beim Zahnarzt und feige vor dem Examen – oder umgekehrt . . . der andere auch. Du machst so eine komische Bewegung mit den Kinnbacken, wenn du ein Buch aufschneidest . . . Immer, immer: der andere auch.
Ja, zum Donnerwetter, sollen wir denn nun gar nichts mehr haben, das uns ganz allein gehört? Doch, das gibt es vielleicht . . . aber es finden sich stets, wenn man näher zusieht, Hunderte, die machen es dann doch genau so, und Tausende, die machen es beinah so, und Zehntausende, die machen es ähnlich . . . der andere auch.
Es tut gut, das zu wissen.
Denn nichts ist gefährlicher, als den Partner zu niedrig einzuschätzen – auf diese Weise sollen schon Kriege verloren gegangen sein. Glaub du ja nicht, du seist der einzig Schlaue weit und breit; du allein verständest den Reiz der Einsamkeit auszukosten; habest allein den Wunsch, mit einer Frau auf einer einsamen Insel (für vier Wochen) zu wohnen . . . glaub das nicht. Und doch glauben wir es im stillen alle.
Wir besetzen das Theater des Lebens so:
Hauptrolle: ICH. Dann eine ganze Weile gar nichts. Dann eine unübersehbare Statisterie: die andern. Nicht, daß wir sie nun alle für dämlich hielten . . . aber eben doch nur: für die 'andern' . . . und es gehört schon eine ganze Menge Lebensklugheit, nein, Weisheit dazu, einzusehen, daß es mit den andern im Grunde genau, aber ganz genau so bestellt ist, wie mit uns. Denn jeder von ihnen hat schon verzweifelt vor einem Haus auf eine Frau gewartet und dabei an dem Haus hochgesehen wie an einem bösen Urwelttier . . . jeder von ihnen hatte seinen kleinen Stolz, als er sich freigeschwommen hatte; jeder von
ihnen hat vier kleine dumme Gegenstände in den Schubladen, die behangen sind mit Erinnerungen . . . jeder hat das. Nicht nur du allein. Nicht nur ich allein. Jeder hat, um es mit einem Wort zu sagen, die unaufgeräumte kleine Schublade, auf die jeder so stolz ist, als habe er sie ganz allein.
Nach einigen Schwedenpünschen
beginnen Sie zu wünschen:
Sie drehen ganz im stillen
die bunten Zuckerpillen:
"Ein Wochenendhäuschen . . . und dann einen
Beruf, der einem Spaß macht . . . nein, überhaupt
keinen Beruf . . . eine anständige Rente . . . weißt
du, so eine, die nicht zu sehr beschwert . . . also
sagen wir: 500 Mark im Monat, na, ich wär schon
mit 800 zufrieden – also die Rente . . . dann würd
ich studieren . . . und angeln . . . und radioba-
steln . . . irgendwo im Grünen, im Stillen . . . eine
nette Frau . . . Kinder . . . und nichts von der Welt
hören und sehen – aber das sind so meine Privat-
wünsche . . . das kann man keinem Menschen
sagen – das versteht ja keiner . . ."
Ach!
Damit stehn Sie aber nicht vereinzelt da!
So was denkt man von Florenz bis Altona!
Was Sie da so treiben, das hat lange im
Gebrauch
der andere auch!
der andere auch!
der andere auch!
Man schluckt voll Wut mitunter,
weil man muß, so manches runter.
In der Nacht, beim Mondenscheine,
nimmt man Rache – ganz alleine:
"Ich bin zu gut für diese Welt . . . diese Kerls kön-
nen mir alle nicht das Wasser reichen . . . die füh-
len eben, daß ich mehr bin, als sie . . . daher die
Wut . . . laßt mich mal was werden, laßt mich bloß
mal was werden! – dann kenne ich die Brüder alle
nicht mehr! – doch: ich kenne sie . . . Ich sage
dann ganz freundlich, ganz freundlich sage ich:
Guten Tag! Na, wie gehts denn immer? Sind Sie
noch im Geschäft, ja? Ich? Ich reise so in der Welt
umher . . . im Winter war ich in der Schweiz, ja,
Skisport . . . im Sommer geh ich auf meine Besit-
zung in Dänemark . . . Gott, man muß zufrieden
sein –"
Ach!
Damit stehn Sie aber nicht vereinzelt da!
So was denkt man von Florenz bis Altona!
Was Sie da so treiben, das hat lange im
Gebrauch
der andere auch!
der andere auch!
der andere auch!
Sie sagen im Theater:
Diese Menschen . . . heiliger Vater!
Jeder einzelne ein Hund, ein
krummer –
da bin ich doch eine andere
Nummer . . .
"Nu sieh dir mal die Gesichter hier an! Ein dämli-
ches Pack! Nicht wert, daß man ihnen das Stück
hier vorführt . . . verstehns ja doch nicht! – Ich
habe heute nachmittag Kirchengeschichte des frü-
hen Mittelalters gelesen, ich beschäftige mich jetzt
damit ein bißchen . . . glaubst du, daß hier ein
Mensch höhere Interessen hat? Nicht zehn im gan-
zen Theater, das sag ich dir! – Hübsche Frau da
vorn in der Loge . . . wenn man an die ran könn-
te . . . glatt sagte die: ja . . . sie kennt mich bloß
nicht . . . aber wenn sie mich kennen würde . . .
eigentlich sieht man mir ja schon an, daß ich was
Besseres bin, nicht so wie die andern . . ."
Ach!
Damit stehn Sie aber nicht vereinzelt da!
So was denkt man von Florenz bis Altona!
Was Sie da so treiben, das hat lange im
Gebrauch
der andere auch!
der andere auch!
der andere auch –!
Aus: Uhu, 01.06.1931, Nr. 9, S. 72.
Clarisse1 - 28. Mär, 12:56
Der Undankbare verdient eigentlich Nachsicht: er verwechselt sich gewöhnlich bloß mit seinem Wohlthäter.Emanuel Wertheimer (1846 – 1916)
Clarisse1 - 29. Feb, 17:32
von Wilhelm Busch (1832 – 1908)
Ein gutes Tier
Ist das Klavier,
Still, friedlich und bescheiden,
Und muß dabei
Doch vielerlei
Erdulden und erleiden.
Der Virtuos
Stürzt darauf los
Mit hochgesträubter Mähne.
Er öffnet ihm
Voll Ungestüm
Den Leib, gleich der Hyäne.
Und rasend wild,
Das Herz erfüllt
Von mörderlicher Freude,
Durchwühlt er dann,
Soweit er kann,
Des Opfers Eingeweide.
Wie es da schrie,
Das arme Vieh,
Und unter Angstgewimmer
Bald hoch, bald tief
Um Hülfe rief,
Vergeß ich nie und nimmer.
Clarisse1 - 14. Jan, 11:42
von Theodor Fontane (1819 – 1898)
3.
Und wieder hier draußen ein neues Jahr –
Was werden die Tage bringen?!
Wird's werden, wie es immer war,
Halb scheitern, halb gelingen?
Wird's fördern das, worauf ich gebaut,
Oder vollends es verderben?
Gleichviel, was es im Kessel braut,
Nur wünsch' ich nicht zu sterben.
Ich möchte noch wieder im Vaterland
Die Gläser klingen lassen
Und wieder noch des Freundes Hand
Im Einverständnis fassen.
Ich möchte noch wirken und schaffen und tun
Und atmen eine Weile,
Denn um im Grabe auszuruhn,
Hat's nimmer Not noch Eile.
Ich möchte leben, bis all dies Glühn
Rückläßt einen leuchtenden Funken
Und nicht vergeht wie die Flamm' im Kamin,
Die eben zu Asche gesunken.
Clarisse1 - 1. Jan, 21:58
wenn Sie das neue Jahr regieren könnten?
von Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)
Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich
Die ersten Nächte schlaflos verbringen
Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich
Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.
Dann – hoffentlich – aber laut lachen
Und endlich den lieben Gott abends leise
Bitten, doch wieder nach seiner Weise
Das neue Jahr göttlich selber zu machen.
Clarisse1 - 1. Jan, 17:13
von Christian Friedrich Daniel Schubart (1739 – 1791)
O Himmel! höre mein Gebet,
Das aus der Seele zu dir fleht,
Und gib mir in der neuen Zeit
Jerusalems Beredsamkeit;
Die Sprachen aus dem Orient,
Wie sie ein Michaelis kennt;
Latein und Griechisch, weiter nicht,
Wie Heyne und Ernesti spricht;
Französisch, Englisch, Wälsch – nur so,
Wie Voltaire, Hume und Metastasio;
Mach mich zu einem Antiquar,
Wie einstens Winckelmann es war;
Zum Schönen gib mir ein Gesicht,
Wie Mengs und Füeßli, weiter nicht!
Der Weisheit populären Ton
Gib mir von Kant und Mendelssohn,
Geschichte nur so obenhin,
Wie Gatterer und Häberlin;
Geographie wie Büsching nur,
Und Hallers Kenntniß der Natur.
Musik begehr' ich nicht zuviel,
Nur Bachs und Lollis Saitenspiel;
Und Klopstocks ziemliches Genie
Zu einem bischen Poesie –
Und endlich – Hm! – zum Zeitvertreib
Wielands Musarion zum Weib!
Clarisse1 - 1. Jan, 15:48